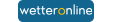Wohnen und Leben in alten Pskower Kaufmannshäusern
Ein Bericht zum Vortrag von Dr. Dieter Weißenborn
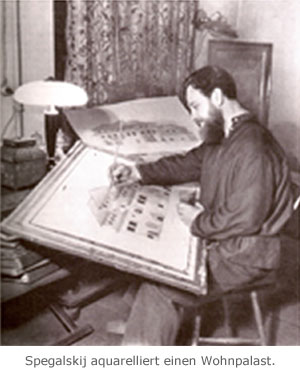 Juri Pawlowitsch Spegalskij (1909 – 1969) war Pskower von Geburt und von Beruf
gelernter Maurer, studierter Ingenieur und Maler mit Doktortitel.
Juri Pawlowitsch Spegalskij (1909 – 1969) war Pskower von Geburt und von Beruf
gelernter Maurer, studierter Ingenieur und Maler mit Doktortitel.
Ihm ist es zu verdanken, dass die Pskower Bürgerhäuser des 17. Jh. nicht in Vergessenheit
gerieten. Das waren Häuser - man kann durchaus von Wohnpalästen sprechen - von Pskower
Kaufleuten, die durch Handel mit dem Baltikum und darüber hinaus sehr reich geworden waren.
Juri Spegalskij, bekennender Heimatfreund von Jugend an, hat in seiner Tätigkeit als
Restaurator in Diensten des Pskower Museums über 50 dieser Wohnpaläste – russisch:
Palati – aus Schutt und Asche der Kriegszerstörungen wieder aufgefunden, dokumentiert
und teils auch rekonstruiert.
Sein Hauptverdienst bestand darin, dass er mit bestem fachlichen Können ausgestattet, die
ehemaligen Standorte dieser großen Gebäudekomplexe vermessen hat und in Ausschnittsplänen
kartographisch festgehalten hat.
Doch dabei blieb es nicht. Wenn der Architekt Spegalskij seine Arbeit getan hatte, setzte er
sein Können als Maler ein. Es blieb nicht bei Architekturskizzen, sondern Schwarz-Weiß-
Zeichnungen und Aquarelle ließen die Prachtbauten vor den Augen der Betrachter wieder lebendig
werden.
Ein anschauliches und wohl auch das prominenteste Bauwerk ist der Pogankin-Palast, genannt
nach seinem Besitzer, einem reichen Pskower Kaufmann. Er hatte sein Geld durch den Handel mit
Leinen, Hanf und Tuchen gemacht. 50 Geschäfte nannte er sein Eigen, aber auch eine Gerberei,
einen Steinspeicher und anderes mehr. Es gehört in dieser Zeit, dem 17. Jh. dazu, dass ein
solcher Mann auch gewählter Stadtvertreter war, Chef der Stadtbank und Haupt des Zollamtes.
Das Geld sprudelte also aus verschiedensten Quellen.
Diesen Bau – auch die Gemächer der Pogankins genannt – nahm Spegalskij genau unter
die Lupe. Zwei Ergebnisse sind von großer Bedeutung für die Bauforschung: Spegalskij fand
heraus, dass auf zwei Steinetagen ein hölzerner Aufbau saß. Diese Holzetagen sahen sehr
schmuck aus. Sie krönten die nüchternen, zweckmäßigen Steinetagen. "Im Holz" wohnte die
Familie, denn die Russen mutmaßten, dass Stein "den Körper aussauge". Von Holz umgeben, lebe
man gesünder, hieß es.
 Warum baute man dann überhaupt in Stein? Nun, der Zar hatte in einem Erlass befohlen, dass
Wohlhabende in Stein zu bauen hätten. Die Regierung in Moskau wollte nicht immer wieder von
verheerenden Bränden in den Städten aufgeschreckt werden. Moskau war immerhin mehrmals
abgebrannt, solange nur in Holz gebaut wurde und die Häuser eng an eng standen.
Warum baute man dann überhaupt in Stein? Nun, der Zar hatte in einem Erlass befohlen, dass
Wohlhabende in Stein zu bauen hätten. Die Regierung in Moskau wollte nicht immer wieder von
verheerenden Bränden in den Städten aufgeschreckt werden. Moskau war immerhin mehrmals
abgebrannt, solange nur in Holz gebaut wurde und die Häuser eng an eng standen.
Zurück nach Pskow. War der Stein bisher dem Kirchenbau vorbehalten, so durfte er jetzt auch
für weltliche Bauten verwendet werden. Die reichen Kaufleute nutzten diese Möglichkeit
reichlich, denn ihr Prestige stieg im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar. Die Hintertür
für gesundes Wohnen hielt man sich offen in den oberen hölzernen Wohnetagen.
Sie entdeckt zu haben, ist das eine Verdienst des akribisch arbeitenden Architekten
Spegalskij. Ein anderer Erfolg ist die Entschlüsselung der Eingänge in diese Wohnpaläste. Sie
lagen immer im Innenhof und eine steile, breite Steintreppe führte in die erste Etage. Hier
lagen die Empfangsräume, die Speisesäle und die großen Räume für Folklore, Tänze und Spiele.
Der Innenhofcharakter diente der Sicherheit. Pskow war immer Grenzstadt und niemals sicher vor
feindlichen Attacken.
Die steile Treppe, die man als Gast emporsteigen musste, kostete schon einmal Kraft, und
beeindruckt war man auch, wenn man oben am Treppenabsatz den Hausherrn stehen sah, der
gelassen auf die Gäste herunterschauen konnte.
Diese Struktur eines Wohnpalastes fand Spegalskij an allen anderen von ihm aufgespürten
Palästen.
Der Pogankin-Palast bleibt für den Pskow-Besucher jedoch der eindringlichste, weil er auch
heute noch Bestand hat. In ihm ist das Pskower Museum untergebracht. Wenn man als
Museumsbesucher die Kunstschätze genossen hat, sollte man sich einen zweiten Durchgang
gönnen und das Gebäude als den Wohnsitz eines reichen Pskower Kaufmanns des 17. Jh.
erleben.
Übrigens: Der Palast der Menschikows, einer anderen Pskower Kaufmannsfamilie des 17. Jh.,
wurde – wie es heißt – von einem Moskauer Investor erworben und in ein Hotel mit
verschiedenen Restaurants umgewandelt. Und das geschah denkmalgerecht im alten Stil. Auch hier
klimmt man eine steile Treppe empor, um es sich dann in großzügigen Gasträumen in altem
Gemäuer gut gehen zu lassen.
Viele Einrichtungsgegenstände in den restaurierten Räumen sind alt oder getreu der alten
russischen Volkskunst nachempfunden.
Auch hier kann Spegalskij Pate stehen. Bei seinen Forschungen fand er im Kulturschutt Kacheln
von alten Kachelöfen bis hin zu Resten alter Ikonenschränke. Ein solcher Ikonenschrank
– auch Kiot genannt – befand sich in repräsentativen Räumen und reichte vom Boden
bis zur Decke.
Der wirtschaftliche Aufschwung und der Bauboom in Pskow zu Beginn des 17. Jh. hat erstaunliche
Parallelen zu Neuss.
Beide heutigen Partnerstädte mussten am Ende des 16. Jh. herbe Schläge erdulden. In den
1580-er Jahren stand ein 100.000 Mann starkes polnisches Heer vor Pskow. Das Kriegsglück
wechselte häufig. Und die Stadt Pskow war am Ende verwüstet.
In den 1580-er Jahren eroberten die Truchsessischen Neuss und ein verheerender Brand gab der
Stadt den Rest. Erst Anfang des 17. Jh. ging es auch in unserer Stadt wieder bergauf.
Das ist wahrlich eine Duplizität der Schicksalsschläge, die beide Städte erlitten und
verkraften mussten.
Text: Dr. D. Weißenborn